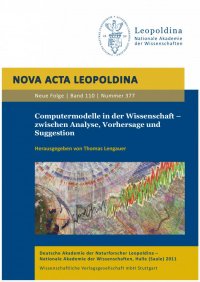
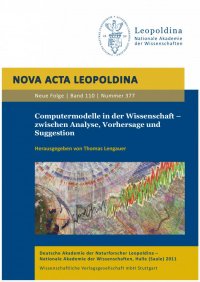
1. Das Problem: Wissenschaft ohne Taxonomie Was soll man eigentlich von einer Wissenschaft halten, deren Gegenstand nicht bestimmt ist? Eine böswillige Antwort wäre, dass es sich gar nicht um eine „Wissenschaft“ handelt, eine gutwillige Antwort wäre, dass Wissenschaftler, die sich für etwas Bestimmtes interessieren, auf der ehrlichen Suche nach ihrem Gegenstand sind. Was ist dieses „Bestimmte“, auf das sich das Suchen bezieht? Hier beginnt bereits die Schwierigkeit. Ist es die Sehnsucht nach Antworten auf die Frage, wie wir die Welt erkennen, wie wir also sehen und hören, und wie wir darüber denken, oder suchen wir Antworten auf Fragen, was mit Bewusstsein, Geist oder Seele gemeint sein könnte, oder geht es darum zu verstehen, wie das, was wir erleben, das Psychische, und das, was in unserem Gehirn geschieht, etwas Körperliches also, miteinander verflochten sind? Doch dies sind noch nicht genug der Fragen: Warum verhalten sich Men- schen so, wie sie es tun? Was kann man über uns selbst von anderen Lebewesen erfahren, und was kann man von anderen Wissenschaften wie der Philosophie oder der Physik lernen? Dann tauchen Fragen auf, die ins Philosophische oder sogar Theologische hineinreichen: Woher wissen wir eigentlich, wer wir sind, wie bestimmt sich also personale Identität? Hat das, was geschieht, einen Sinn? Warum sind wir manchmal glücklich, dann aber auch unglücklich? Was sind die Gründe des Verrücktseins? Was bedeuten andere Menschen für uns, da wir doch immer in eine soziale Welt eingebunden sind? Was ist es also, das diese „Noch-Nicht-Wis- senschaft“ ausmachen könnte? Vermutlich von allem etwas, was aber, indem es nur aufgezählt wird, eine unbefriedigende Antwort wäre, trotz aller Versuche, die die Geschichte dieses Su- chens ausmachen.1 Der Grund für diese Undeutlichkeit, für die anhaltende Suche nach dem „Bestimmten“, ist das Fehlen einer verbindlichen Taxonomie von Funktionen (PöPPEL 1984, 1988, 1989). Es fehlt eine klare Ordnung und Klassifikation dessen, worum es eigentlich geht. Die Biologie wurde zur Wissenschaft durch die Klassifikation der Lebewesen durch Carl VON LINNé, auf der dann Charles DARWIN mit seiner Lehre von der Evolution des Lebendigen aufbauen konnte (MAyR 2001), die Chemie durch das Periodensystem von Dmitri Iwanowitsch MENDELEJEW und Lothar MEyER, von der Physik mit ihren in mathematischer Sprache geschriebenen Ge- setzen ganz zu schweigen (FEyNMAN 1965), doch was ist mit der Psychologie? Man behilft sich mit Modellen (PöPPEL et al. 1991). Dieser Behelf hat einen Reiz in sich, doch ersetzt dieser natürlich nicht die grundsätzliche Forderung nach Ordnungsprinzipien, wie sie für an- dere Wissenschaften gelten. Welches sind nun diese Modelle, an denen wir uns orientieren, wobei bei deren Betrach- tung immer an eine Forderung des Philosophen und Logikers Rudolf CARNAP (1928) gedacht werden sollte, dass Modelle nämlich vier Kriterien gehorchen müssen: Modelle sollen „ein- fach, exakt, ähnlich und fruchtbar“ sein. Es ist offenkundig, dass alle diese Forderungen für die Psychologie – wie im übrigen für jede Wissenschaft – schwer zu erfüllen sind. Das Pro- blematische bezieht sich im Wesentlichen auf die Forderung nach ähnlichkeit; wenn der Ge- genstand nicht klar bestimmt ist, zu was kann dann ähnlichkeit hergestellt werden? Die anderen Forderungen lassen sich zum Teil erfüllen, dass manche Modelle also durchaus exakt sein können, oder dass sie einfach sein können, wobei sie allerdings häufig zu einfach ausfal- Psychologie als eine auf Modelle angewiesene Angelegenheit ohne Taxonomie – eine Polemik Nova Acta Leopoldina NF 110, Nr. 377, 213–233 (2011) 215 1 BACON 1620, BORING 1933, CASSIRER 1994, DARWIN 1872, DESCARTES 1637, EIBL-EIBESFELDT 1995, FECHNER 1860, FODOR 1983, FREUD 1932, JAMES 1890, LA METTRIE 1748, PöPPEL 1997, 2006, SEARLE 1992, SKINNER 1974, STEVENS 1986, TINBERGEN 1956.