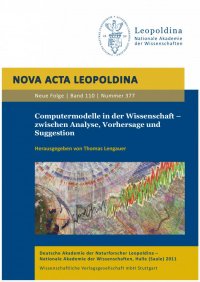
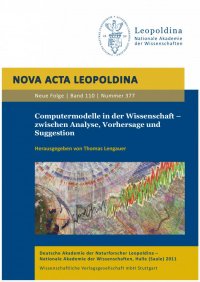
man sich die Frage, welches Prinzip für einen Organismus absolut notwendig ist, so wird man zu der Antwort geführt, dass es sich um die Regulation der Homöostase handelt. Jeder Organismus versucht, zur Lebenserhaltung ein inneres Gleichgewicht zu sichern. Dieses kann durchaus ein dynamisches Gleichgewicht sein, wie Studien zu circadianen Rhythmen nahelegen, dass also biologische zustände einer tagesperiodischen Schwankung unterliegen (PöPPEL 1968, 1997). Es hat sich nun gezeigt, dass bereits Einzeller für ihre homöostatische Regulation zielgerichtetes Verhalten einsetzen. Diese Tatsache allein, auf ein ziel hinzusteu- ern, um in eine Situation zu kommen, in der die Bedingungen für den Organismus günstiger sind, hat erhebliche Implikationen für das Verständnis seiner hierfür erforderlichen Opera- tionen. Wenn Situationen aufgesucht werden, die für den Organismus günstiger sind, dann muss es eine Instanz geben, die dieses „günstiger“ vermittelt. Wie diese Instanz im Organismus re- präsentiert ist, dies ist eine völlig offene Frage. Bei der Beschreibung der einzelnen Kompo- nenten des zielgerichteten Verhaltens schon des Einzellers ist man notgedrungen auf die Verwendung der menschlichen Sprache angewiesen, ohne hoffentlich in die Falle des Anthro- pomorphisierens zu geraten. Wenn etwas „günstiger“ ist, dann muss es im Organismus einen Prozess geben, der etwas mit „Vergleichen“ zu tun hat; der Philosoph Rudolf CARNAP, auf den wir uns zu Beginn bei den Kriterien von Modellen bezogen haben, war der Meinung, dass der „Vergleich“ die Grundoperation des menschlichen Geistes überhaupt sei. Man sieht aber be- reits aus der obigen überlegung, dass Vergleichen selbst bei einfachsten Lebewesen vorkom- men muss. Bevor der Organismus aber in die Lage kommt, etwas miteinander zu vergleichen, muss dieses „Etwas“ erst bestimmt werden. Wir werden zu der Schlussfolgerung gezwungen, dass bereits der Einzeller ohne eine neuronale Struktur Ereignisse definieren kann, also „Etwas als Etwas“ identifizieren kann, denn nur auf dieser Grundlage ist es ihm möglich, eine zielge- richtete Bewegung zu programmieren. Am Beginn des Lebens steht also die Fähigkeit von Organismen, eine bestimmte Situation zu identifizieren, und diese als Kategorie für weitere Arbeitsschritte zu speichern. Der erforderliche Vergleich kann nun nicht gleichzeitig erfolgen, sondern beim Vergleich müssen zwei kategoriale zustände aufeinander bezogen werden, die zeitlich voneinander getrennt repräsentiert sind. Damit muss der Organismus ein „Arbeitsge- dächtnis“ haben, um zwei äquivalente zustände in einem kurzen zeitlichen Abstand hinsicht- lich eines möglichen Unterschiedes bewerten zu können. Wenn es jedoch auf den Unterschied ankommt, dann muss bereits das Konzept der „Schwelle“ in einem solchen Organismus im- plementiert sein, dass also erst ab einer bestimmten Differenz von einem Unterschied gespro- chen werden kann, der bei einem Vergleich festgestellt wird. Wenn wir von der Bestimmung kategorialer zustände sprechen, dann können wir auch von „Wahrnehmung“ sprechen; einzellige Organismen identifizieren mit Hilfe bestimmter molekularer Verbindungen in ihrer Membran beispielsweise chemische Gradienten, oder die Intensität oder spektrale Komponenten des Lichts. Die sensorische Kompetenz ist die Bedin- gung für die Bestimmung kategorialer zustände und die Voraussetzung eines möglichen Ver- gleichs, auf dessen Grundlage dann eine Wahl getroffen werden kann, also die zuordnung eines kategorialen zustandes zu einer bestimmten Menge. Eine Wahl ist wiederum die Vor- aussetzung einer Entscheidung, nämlich sich in einer bestimmten Richtung zu bewegen, um in eine Situation zu kommen, in der die Lebensverhältnisse günstiger sind. Die vorausgehen- den Funktionen sind unter dieser Perspektive also Dienstleistungsfunktionen einer zielgerich- teten Bewegung. Eine solche Bewegung aber überhaupt zu programmieren, setzt des Weiteren Nova Acta Leopoldina NF 110, Nr. 377, 213–233 (2011) Ernst Pöppel und Eva Ruhnau 226